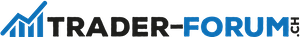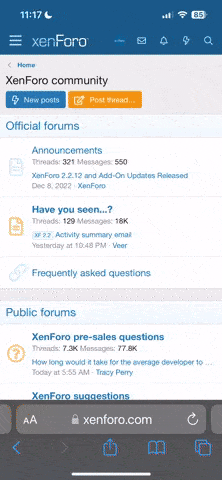Der Handel mit Rohstoffen ist ein gigantischer Markt. Die Schweiz ist die zentrale Drehscheibe, nicht nur wegen der einheimischen Branchenriesen Glencore und Xstrata, sondern auch wegen Genf, des weltweit wichtigsten Handelsplatzes für Rohstoffe. Wie das Geschäft mit den Schätzen dieser Erde funktioniert.
http://epaper.nzz.ch/data_ep/NZZS/20120 ... 595125.png
http://epaper.nzz.ch/data_ep/NZZS/20120 ... 595125.png
Der Stoff
Rohstoffe sind das Blut in den Adern der Weltwirtschaft und die Basis des westlichen Wohlstands. Der Hunger nach ihnen ist riesig. 70 Prozent der Schiffsladungen, die jedes Jahr durch die Welt gefahren werden, bestehen aus Rohstoffen. In Dollar gerechnet machen sie einen Viertel des gesamten Welthandelsvolumens aus.
Unterschieden werden drei Gruppen: 1. Energieträger wie Erdöl, Gas und Kohle. 2. Mineralien wie Kupfer, Gold oder Eisen, aber auch Diamanten. 3. Agrargüter, etwa Getreide, Planzenöl, Kaffee, Zucker oder Baumwolle.
Die bedeutendsten Rohstoffe sind die Energierohstoffe, konkret: Erdöl. Rund die Hälfte des Geldes, das mit dem Rohstoffexport verdient wird, stammt aus Einnahmen des Erdölverkaufs. Nach einem Rückgang während der Finanzkrise ist der Verbrauch 2010 wieder deutlich angestiegen. Die Förderung von Erdöl und von Erdgas erreichte 2010 Rekordwerte. Aber auch die Förderung von Metallen wächst ungebremst. Ohne Stoffe wie Kupfer, Nickel oder Koltan funktioniert kein Handy. Die meisten Rohstoffe stammen aus Entwicklungsländern und werden zum Teil mit Schäden für Mensch und Natur abgebaut. 59 Prozent der Metalle und zwei Drittel des Erdöls und der Kohle kommen aus solchen Staaten. Am meisten Rohstoffe verbrauchen China, die USA, Japan und Deutschland.
Die Akteure
Am Anfang des Rohstoffabbaus an einem Ort stehen oft kleine Unternehmen, die ihr Glück versuchen und mit lokalen Obrigkeiten Schürfrechte aushandeln. «Haben sie Erfolg, sind in der Regel bald grössere Firmen auf dem Platz und kaufen die Mine», sagt Oliver Classen, der Sprecher der Nichtregierungsorganisation «Erklärung von Bern». Je nach Ausbeute werden diese von noch grösseren Firmen abgelöst. Am Ende dieser «Nahrungskette» stehen die globalen Bergbaukonzerne:
BHP Billiton: Der britisch-australische Konzern ist das grösste Bergbauunternehmen der Welt. Mit einem Börsenwert von rund 200 Milliarden Dollar ist es die global fünftteuerste Firma.
Vale: Die Nummer zwei aus Brasilien hat einen Börsenwert von 140 Milliarden Dollar. Sie ist der grösste Lieferant von Eisenerz. Und sie ist der grösste Transportkonzern Brasiliens.
Rio Tinto: Ein Börsenwert von 120 Mrd. Dollar macht das britisch-australische Unternehmen zur Nummer drei. Es fördert vor allem Eisenerz, schürft aber auch Kohle, Aluminium, Kupfer, Gold und Diamanten.
Glencore/Xstrata: Die beiden Schweizer Firmen wären nach der geplanten Fusion 90 Milliarden Dollar wert und das viertgrösste Rohstoffunternehmen. Die Schweizer sind unter den Marktriesen die Einzigen, die nicht nur Rohstoffe fördern, sondern sie auch vermarkten und damit die gesamte Wertschöpfungskette besetzen. Glencore/Xstrata wären Marktleader in der Förderung von Kupfer, Kohle und Zink.
China Shenhua: Der Konzern mit einem Wert von 85 Milliarden Dollar baut vor allem Kohle ab und verheizt sie in eigenen Kohlekraftwerken. Neben den Bergbauunternehmen bestimmen grosse Handelsfirmen wie Vitol (Schweiz) oder Gunvor (Niederlande) den Markt.
Die Schaltzentrale
Gehandelt und verschifft werden die Stoffe an wenigen Drehpunkten in den USA, Europa und Asien. Das Zentrum dieses globalen Geschäfts ist Genf. Darin sind sich Experten einig. Die Stadt hat in den letzten Jahren London als Nummer eins abgelöst. Die Bilanz der Geneva Trading and Shipping Association (GTSA), der Vereinigung der Genfer Rohstoffbranche, ist beeindruckend. Ein Drittel des global gehandelten Rohöls wird über Genf gekauft und verkauft. Vor allem der Handel mit russischem Öl findet vornehmlich in der Schweiz statt. Die Stadt ist weltweit Nummer eins im Handel mit Getreide, Pflanzenölen und Baumwolle sowie der führende europäische Handelsplatz für Zucker. Die Handelsfirmen für diese Stoffe haben einen Sitz in Genf, viele sind Schweizer Firmen.
Die Gründe dafür liegen einerseits an den tiefen Steuern, aber nicht nur, wie ein Branchen-Insider in Genf sagt. Entscheidend ist das Umfeld. Handelsgeschäfte sind teuer und darum zu 90 Prozent durch Bankkredite finanziert. Kein anderer Finanzplatz ist derart auf die Handelsfinanzierung spezialisiert wie Genf. Französische und Schweizer Banken haben ihre Experten hier. Daneben hat sich eine Industrie von Dienstleistungen gebildet: Versicherungen, fachkundige Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, Treuhänder, Speditions- und Sicherheitsfirmen. Auch die grösste Warenprüfungsgesellschaft SGS sitzt in Genf. Laut der GTSA sind am Genfersee 400 Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern im Rohstoffgeschäft tätig. «Es ist eine grosse Familie, die zusammengekommen ist», sagt ein Branchenkenner.
Neben Genf besteht ein weiterer Standort in Zug, wo Glencore/Xstrata ihren Hauptsitz hat und den Handel mit Kupfer, Kohle und Zink dominiert. Und schliesslich handeln die Kaffeehändler in der ganzen Schweiz die Hälfte der weltweiten Ernte.
Es erstaunt daher nicht, dass der Rohstoffhandel in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Schweiz geworden ist. Allein am Handelsplatz Genf sollen die Unternehmen 2009 Rohstoffe im Wert von rund 800 Milliarden Franken umgeschlagen haben. Das wäre ein Viertel des globalen Rohstoffhandels. Laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) hat die Branche 2011 einen Nettoumsatz von 23 bis 24 Milliarden Franken erzielt, zwei Jahre zuvor war es halb so viel gewesen. Die Wertschöpfung der Branche, so die KOF, sei «vergleichbar mit der der Banken- oder Versicherungswirtschaft».
Das Risiko
Der Boom freut nicht alle. Die Organisation «Erklärung von Bern» spricht in ihrem Buch über den hiesigen Rohstoffhandelsplatz vom «gefährlichsten Geschäft der Schweiz». Auch von offizieller Seite sind Bedenken zu hören. «Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist eine politische Zeitbombe», sagte Martin Dahinden, der Chef der Eidgenössischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, letztes Jahr an einer Podiumsdiskussion. Was er meinte, wollte er diese Woche auf Anfrage nicht ausführen, doch es liegt auf der Hand. Rohstoffunternehmen produzieren negative Schlagzeilen. Die Vorwürfe sind happig: Korruption, Ausbeutung von Arbeitern, mangelnde Sicherheit in den Minen. Umweltverschmutzung, Steuerflucht. Man befürchtet Reputationsschäden für die Schweiz. Nicht von ungefähr: Glencore etwa, die grösste Firma der Schweiz, teilte 2010 noch mit, sie wisse nichts von relevanten Umweltverschmutzungen an ihren Standorten. Laut einem Bericht der Risikoanalysen-Firma Reprisk in Kolumbien wurde sie zu einer Busse von 700 000 Dollar verurteilt - wegen Umweltverschmutzung.
Der Geldwäscherei-Experte Mark Pieth sagte 2011 in einem Interview, die Politik habe die Probleme noch nicht erkannt, die diese Branche mit sich bringe. Organisationen wie die «Erklärung von Bern» fordern eine Anwendung des Geldwäschereigesetzes auf Rohstoffhändler, mehr Transparenz, die Abschaffung von Steuerprivilegien und eine Strategie, die sicherstellt, dass Schweizer Firmen und solche mit ihrem Konzernsitz hier für Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen geradestehen müssen.
Was passiert, entscheidet demnächst das Parlament. Ein Postulat der SP verlangt eine Strategie des Bundesrates, um Reputationschäden zu verhindern. Der Vorstoss ist umstritten.
Quelle: NZZ am Sonntag
http://epaper.nzz.ch/data_ep/NZZS/20120 ... 595125.png
http://epaper.nzz.ch/data_ep/NZZS/20120 ... 595125.png
Der Stoff
Rohstoffe sind das Blut in den Adern der Weltwirtschaft und die Basis des westlichen Wohlstands. Der Hunger nach ihnen ist riesig. 70 Prozent der Schiffsladungen, die jedes Jahr durch die Welt gefahren werden, bestehen aus Rohstoffen. In Dollar gerechnet machen sie einen Viertel des gesamten Welthandelsvolumens aus.
Unterschieden werden drei Gruppen: 1. Energieträger wie Erdöl, Gas und Kohle. 2. Mineralien wie Kupfer, Gold oder Eisen, aber auch Diamanten. 3. Agrargüter, etwa Getreide, Planzenöl, Kaffee, Zucker oder Baumwolle.
Die bedeutendsten Rohstoffe sind die Energierohstoffe, konkret: Erdöl. Rund die Hälfte des Geldes, das mit dem Rohstoffexport verdient wird, stammt aus Einnahmen des Erdölverkaufs. Nach einem Rückgang während der Finanzkrise ist der Verbrauch 2010 wieder deutlich angestiegen. Die Förderung von Erdöl und von Erdgas erreichte 2010 Rekordwerte. Aber auch die Förderung von Metallen wächst ungebremst. Ohne Stoffe wie Kupfer, Nickel oder Koltan funktioniert kein Handy. Die meisten Rohstoffe stammen aus Entwicklungsländern und werden zum Teil mit Schäden für Mensch und Natur abgebaut. 59 Prozent der Metalle und zwei Drittel des Erdöls und der Kohle kommen aus solchen Staaten. Am meisten Rohstoffe verbrauchen China, die USA, Japan und Deutschland.
Die Akteure
Am Anfang des Rohstoffabbaus an einem Ort stehen oft kleine Unternehmen, die ihr Glück versuchen und mit lokalen Obrigkeiten Schürfrechte aushandeln. «Haben sie Erfolg, sind in der Regel bald grössere Firmen auf dem Platz und kaufen die Mine», sagt Oliver Classen, der Sprecher der Nichtregierungsorganisation «Erklärung von Bern». Je nach Ausbeute werden diese von noch grösseren Firmen abgelöst. Am Ende dieser «Nahrungskette» stehen die globalen Bergbaukonzerne:
BHP Billiton: Der britisch-australische Konzern ist das grösste Bergbauunternehmen der Welt. Mit einem Börsenwert von rund 200 Milliarden Dollar ist es die global fünftteuerste Firma.
Vale: Die Nummer zwei aus Brasilien hat einen Börsenwert von 140 Milliarden Dollar. Sie ist der grösste Lieferant von Eisenerz. Und sie ist der grösste Transportkonzern Brasiliens.
Rio Tinto: Ein Börsenwert von 120 Mrd. Dollar macht das britisch-australische Unternehmen zur Nummer drei. Es fördert vor allem Eisenerz, schürft aber auch Kohle, Aluminium, Kupfer, Gold und Diamanten.
Glencore/Xstrata: Die beiden Schweizer Firmen wären nach der geplanten Fusion 90 Milliarden Dollar wert und das viertgrösste Rohstoffunternehmen. Die Schweizer sind unter den Marktriesen die Einzigen, die nicht nur Rohstoffe fördern, sondern sie auch vermarkten und damit die gesamte Wertschöpfungskette besetzen. Glencore/Xstrata wären Marktleader in der Förderung von Kupfer, Kohle und Zink.
China Shenhua: Der Konzern mit einem Wert von 85 Milliarden Dollar baut vor allem Kohle ab und verheizt sie in eigenen Kohlekraftwerken. Neben den Bergbauunternehmen bestimmen grosse Handelsfirmen wie Vitol (Schweiz) oder Gunvor (Niederlande) den Markt.
Die Schaltzentrale
Gehandelt und verschifft werden die Stoffe an wenigen Drehpunkten in den USA, Europa und Asien. Das Zentrum dieses globalen Geschäfts ist Genf. Darin sind sich Experten einig. Die Stadt hat in den letzten Jahren London als Nummer eins abgelöst. Die Bilanz der Geneva Trading and Shipping Association (GTSA), der Vereinigung der Genfer Rohstoffbranche, ist beeindruckend. Ein Drittel des global gehandelten Rohöls wird über Genf gekauft und verkauft. Vor allem der Handel mit russischem Öl findet vornehmlich in der Schweiz statt. Die Stadt ist weltweit Nummer eins im Handel mit Getreide, Pflanzenölen und Baumwolle sowie der führende europäische Handelsplatz für Zucker. Die Handelsfirmen für diese Stoffe haben einen Sitz in Genf, viele sind Schweizer Firmen.
Die Gründe dafür liegen einerseits an den tiefen Steuern, aber nicht nur, wie ein Branchen-Insider in Genf sagt. Entscheidend ist das Umfeld. Handelsgeschäfte sind teuer und darum zu 90 Prozent durch Bankkredite finanziert. Kein anderer Finanzplatz ist derart auf die Handelsfinanzierung spezialisiert wie Genf. Französische und Schweizer Banken haben ihre Experten hier. Daneben hat sich eine Industrie von Dienstleistungen gebildet: Versicherungen, fachkundige Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, Treuhänder, Speditions- und Sicherheitsfirmen. Auch die grösste Warenprüfungsgesellschaft SGS sitzt in Genf. Laut der GTSA sind am Genfersee 400 Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern im Rohstoffgeschäft tätig. «Es ist eine grosse Familie, die zusammengekommen ist», sagt ein Branchenkenner.
Neben Genf besteht ein weiterer Standort in Zug, wo Glencore/Xstrata ihren Hauptsitz hat und den Handel mit Kupfer, Kohle und Zink dominiert. Und schliesslich handeln die Kaffeehändler in der ganzen Schweiz die Hälfte der weltweiten Ernte.
Es erstaunt daher nicht, dass der Rohstoffhandel in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Schweiz geworden ist. Allein am Handelsplatz Genf sollen die Unternehmen 2009 Rohstoffe im Wert von rund 800 Milliarden Franken umgeschlagen haben. Das wäre ein Viertel des globalen Rohstoffhandels. Laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) hat die Branche 2011 einen Nettoumsatz von 23 bis 24 Milliarden Franken erzielt, zwei Jahre zuvor war es halb so viel gewesen. Die Wertschöpfung der Branche, so die KOF, sei «vergleichbar mit der der Banken- oder Versicherungswirtschaft».
Das Risiko
Der Boom freut nicht alle. Die Organisation «Erklärung von Bern» spricht in ihrem Buch über den hiesigen Rohstoffhandelsplatz vom «gefährlichsten Geschäft der Schweiz». Auch von offizieller Seite sind Bedenken zu hören. «Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist eine politische Zeitbombe», sagte Martin Dahinden, der Chef der Eidgenössischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, letztes Jahr an einer Podiumsdiskussion. Was er meinte, wollte er diese Woche auf Anfrage nicht ausführen, doch es liegt auf der Hand. Rohstoffunternehmen produzieren negative Schlagzeilen. Die Vorwürfe sind happig: Korruption, Ausbeutung von Arbeitern, mangelnde Sicherheit in den Minen. Umweltverschmutzung, Steuerflucht. Man befürchtet Reputationsschäden für die Schweiz. Nicht von ungefähr: Glencore etwa, die grösste Firma der Schweiz, teilte 2010 noch mit, sie wisse nichts von relevanten Umweltverschmutzungen an ihren Standorten. Laut einem Bericht der Risikoanalysen-Firma Reprisk in Kolumbien wurde sie zu einer Busse von 700 000 Dollar verurteilt - wegen Umweltverschmutzung.
Der Geldwäscherei-Experte Mark Pieth sagte 2011 in einem Interview, die Politik habe die Probleme noch nicht erkannt, die diese Branche mit sich bringe. Organisationen wie die «Erklärung von Bern» fordern eine Anwendung des Geldwäschereigesetzes auf Rohstoffhändler, mehr Transparenz, die Abschaffung von Steuerprivilegien und eine Strategie, die sicherstellt, dass Schweizer Firmen und solche mit ihrem Konzernsitz hier für Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen geradestehen müssen.
Was passiert, entscheidet demnächst das Parlament. Ein Postulat der SP verlangt eine Strategie des Bundesrates, um Reputationschäden zu verhindern. Der Vorstoss ist umstritten.
Quelle: NZZ am Sonntag